Am Anfang war die Nase. Besser gesagt: die etwas gross geratene Nasenprothese in Bradley Coopers Gesicht, die er benutzte, um im Film «Maestro» den legendären Leonard Bernstein (1918– 1990) zu verkörpern. Das sorgte im Sommer für Empörung. Von «Jewfacing» war die Rede: Gemeint ist die Verwendung stereotyper Merkmale von Nicht-Juden, um Juden darzustellen. Bei der Festivalpremiere in Venedig entschuldigte sich «Maestro»-Maskenbildner Kazu Hiro bei jenen, die sich verletzt fühlten.
Die Sache war dann aber rasch vom Tisch, als sich Bernsteins Kinder einschalteten: «Bradley Cooper hat sich entschieden, Make-up zu benutzen, um seine Ähnlichkeit zu verstärken, und wir sind damit völlig einverstanden.» So viel zur Nase. «Maestro» ist nach «A Star Is Born» die zweite Regiearbeit von Cooper. Und es ist offensichtlich: Der 48-jährige US-Amerikaner schafft es abermals, aus klassischem Material – wieder zum Thema Musik, aber diesmal biografisch – eine originelle Geschichte zu destillieren.
Im Fokus steht dabei weniger die Karriere, als vielmehr die Beziehung des Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein zu seiner Frau, der chilenischen Schauspielerin Felicia Montealegre (Carey Mulligan).
Die Hochs und Tiefs sind ein Erlebnis
Als sich die beiden in den 40er-Jahren erstmals und in Schwarz-Weiss begegnen, wähnt man sich fast in einer Screwball-Comedy, so überdreht wirken die Figuren. Dabei verschwimmt die Realität in einer wunderbar choreografierten Tanzrevue zur Fiktion, geraucht und geküsst wird ohnehin auf Teufel komm raus. Als die Bilder in den 60ern farbig werden, beginnen jedoch die Probleme.
Felicia realisiert, dass ihr Mann nicht nur ein unermüdlicher Komponist und Dirigent ist, sondern auch ein übermüdeter Vater und Ehemann, der sich nach anderen Männern sehnt. Da springt die Frau dann auch mal aus Frust in den Pool und hält im Sitzstreik unter Wasser die Luft an. Diese emotionalen Hochs und Tiefs sind dank Mulligans und Coopers offenherzigem Spiel ein Erlebnis.
Das beginnt schon in der ersten Szene, wenn der alte Leonard Bernstein vor einem TV-Team zu Hause in die Tasten greift und nicht anders kann, als um seine an Krebs verstorbene Frau zu weinen. Noch bemerkenswerter ist allerdings die Kameraführung von Matthew Libatique. Einmal spricht Bernstein aus einem stockfinsteren Raum, ein andermal verfolgt die Kamera ein Gespräch zwischen den Eheleuten in der Gartenlaube wie ein Spanner aus der Distanz.
Eine herausragende Kameraführung
Die vielleicht prägnanteste Szene des Films ist aber jene, als Bernstein in einer Kirche dirigiert. Da fährt die Kamera langsam auf ihn zu, zeigt ihn im vollsten Furioso. Dann aber zieht sie sich zurück, ganz langsam, bis erst zum Schluss des Stücks Felicia ins Bild rückt, die von ihrem heranstürmenden Ehemann mit Küssen überhäuft wird. Diese Szene allein ist, aus Mangel einer besseren Umschreibung, ganz grosses Kino.
Maestro
Regie: Bradley Cooper
USA 2023, 129 Minuten
Ab Do, 7.12., im Kino
Ab Mi, 20.12., auf Netflix
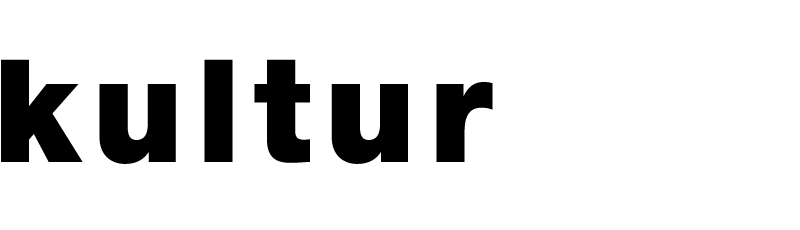

Kommentare zu diesem Artikel
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar hinzuzufügen
Sind Sie bereits Abonnent, dann melden Sie sich bitte an.
Nichtabonnenten können sich kostenlos registrieren.
Besten Dank für Ihre Registration
Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Registration.
Keine Kommentare vorhanden