Inhalt
Richard Yates lebte vom Schreiben – und vom Trinken. Das Erste bekam ihm besser als das Zweite, dennoch gingen seine Bücher vergessen. Erst Jahre nach seinem Tod 1992 erscheinen nun seine Romane wieder: Im Roman «Eine gute Schule» schildert Yates, wie es ihm in der Kriegszeit an der Dorset Academy ergangen ist, einem heruntergekommenen College in Neu-England. Yates (1926– 1992) lernte da wenig Akademisches, aber viel fürs Leben.
Kampf um Anerkennung
Die Geschichte ist schnell erzählt. Die fürsorgliche, aber ärmliche Mutter will das Beste für ihren Sprössling William. Sie überredet ihren Ex-Mann, dem Jungen das College zu finanzieren. Der klarsichtige Vater erkennt zwar schnell, dass die von der Mutter propagierte Dorset Academy kaum intellektuellen Ansprüchen genügen kann.
Dennoch kommt William Grove an diese Schule, wo er von Beginn weg um Anerkennung ringen muss. Er ist eine Niete im Sport, wo amerikanische College-Schüler in der Regel am meisten Meriten holen. Zudem kennt William die sozialen Regeln der Mittelschicht nicht: «Er nahm zusehends eine chronische Demutshaltung ein.» Da wird er Redaktor des Schulblatts und hat damit ein Machtinstrument in der Hand.
Yates schildert auch die Leiden der Lehrer. Der Französischlehrer etwa hintergeht den Chemielehrer mit dessen Frau. Und dann ist da noch die noble Financière der Schule, eine reaktionäre alte Schrulle. Sie will mit ihrem Geld die Welt vor dem Kommunismus retten.
Fazit: Ein spannender Entwicklungsroman über die US-Mittelklasse mit einem Touch von «Der Fänger im Roggen».
[Buch]
Richard Yates
«Eine gute Schule» 231 Seiten
(DVA 2012).
[/Buch]
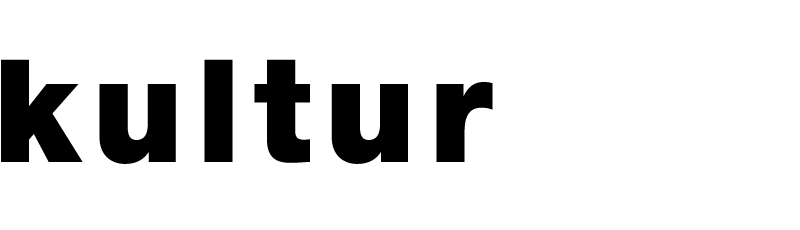

Kommentare zu diesem Artikel
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar hinzuzufügen
Sind Sie bereits Abonnent, dann melden Sie sich bitte an.
Nichtabonnenten können sich kostenlos registrieren.
Besten Dank für Ihre Registration
Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Registration.
Keine Kommentare vorhanden