Inhalt
Als Kind schon sagte Hansi Hölzl, wenn ihn die Schulkameraden hänselten: «Wartet nur, ich werde mal ein grosser Popstar.» Mit 23 wurde aus dem Bassgitarristen Hans der Bandleader Falco, und dieser sang sich in nur zwei Jahren an die Spitze der internationalen Charts. Auf die Nachricht, «Rock Me Amadeus» habe die US-Billboards geknackt, sei Falco in Tränen ausgebrochen, erzählt sein damaliger Gitarrist und Bandleader Peter Vieweger im Dokfilm «Falco – Sterben, um zu leben». Falco weinte freilich nicht aus Glück, sondern aus Desillusion: «Was soll ich jetzt noch erreichen? Das wars.»
Ein unstetes Leben mit viel Alkohol
Der Megastar des Austropop (1957–1998) ist vielen als Energiebündel in Erinnerung, als Pop-Dandy und selbstherrliches Grossmaul. «Wenn er nüchtern war», sagt im Film Keyboarder Thomas Rabitsch, «war der Falco ein liebeswürdiger Mensch.» Seine andere, exaltierte und arrogante Seite war in Alkohol getränkt. Der eigentlich unsichere und hochsensible Künstler spülte Kummer und Scheu mit Whisky runter. Dies führte dazu, dass er sich vor Konzerten jeweils das Blut auswechseln liess, um seine Shows durchzustehen.
In seiner Dokumentation montiert Jobst Knigge Bild- und Film-Dokumente mit Aussagen von Falcos Freunden, seinen Managern, Produzenten sowie seiner vermeintlichen Tochter zu einer Collage, die sein unstetes Leben stimmig darstellt. Dass Falco mit erst 40 im Vollsuff einen tödlichen Autocrash verursachte, ist im Nachhinein für manche seiner Freunde ein «verlängerter Selbstmord».
Falco wollte den Erfolg, hat dessen Wucht und Unerbittlichkeit aber unterschätzt und dafür den höchsten Preis bezahlt. Wie ihm erging es vielen Senkrechtstartenden im Showbusiness. Sein exemplarisches Schicksal bewegt auch knapp 20 Jahre nach seinem Tod.
Falco – Sterben, um zu leben
Regie: Jobst Knigge
Fr, 24.11., 21.35 Arte
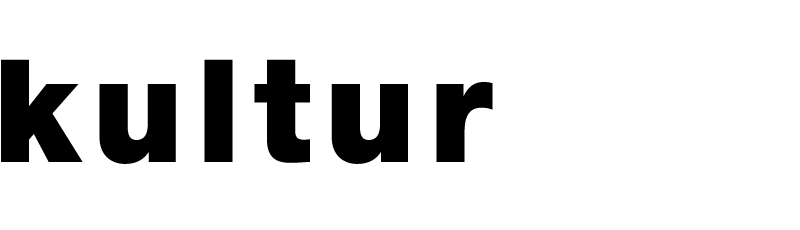
Kommentare zu diesem Artikel
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar hinzuzufügen
Sind Sie bereits Abonnent, dann melden Sie sich bitte an.
Nichtabonnenten können sich kostenlos registrieren.
Besten Dank für Ihre Registration
Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Registration.
Keine Kommentare vorhanden